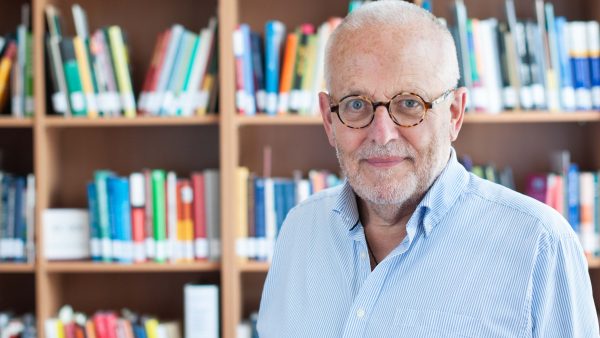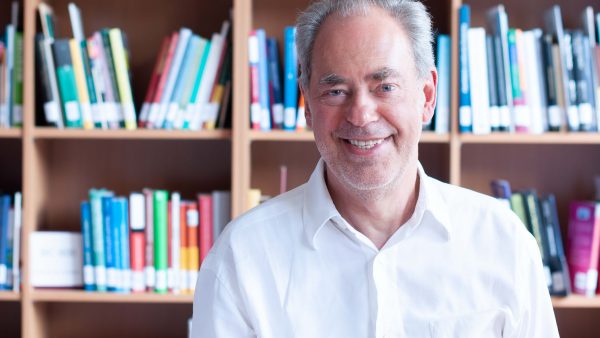Observatorium 71 – Brauchen wir eine neue Engagementstrategie des Bundes?
Observatorium 71 I 07.12.2023 I Eckhard Priller und Rupert Graf Strachwitz
Will der Staat das Engagement wirklich fördern?
„Wir erarbeiten mit der Zivilgesellschaft eine neue nationale Engagementstrategie.“ So steht es recht vollmundig im Koalitionsvertrag für die neue Bundesregierung, den SPD, Grüne und FDP im Dezember 2021 abschlossen. Die Begründung steht in der Präambel: „Eine starke Demokratie lebt von den Menschen, die sie tragen. Sie braucht eine vielfältige Kultur und freie Medien. Ehrenamt und demokratisches Engagement stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie verlässlich zu fördern, ist unsere Aufgabe.“ Die neue Engagementstrategie gehört zu den drei großen Reformen, die sich die Koalition im Hinblick auf die Zivilgesellschaft vorgenommen hat. Von den beiden anderen steckt das Demokratiefördergesetz im Bundestag fest, weil sich die Koalitionsfraktionen nicht einig sind. Von der Reform des Gemeinnützigkeitsrechts wissen wir nur, daß die ersehnte große Reform wieder nicht kommen wird; kleine Anpassungen wurden im Wachstumschancengesetz (!) versteckt und sollen angeblich im nächsten Jahressteuergesetz auftauchen. So könnte die neue Engagementstrategie das zentrale Vorhaben sein, mit dem sich die gegenwärtige Bundesregierung der Zivilgesellschaft zuwendet.
Bis heute hat die Öffentlichkeit noch keinen Entwurf für eine neue Engagementstrategie gesehen. Der einzige Erfolg vieler Bemühungen ist bisher, daß die peinliche Bezeichnung ‚Nationale Engagementstrategie‘ nicht mehr verwendet wird. Sie soll jetzt nüchterner ‚Engagementstrategie des Bundes‘ heißen, – irgendwann – durch einen Beschluß des Bundeskabinetts verabschiedet werden und die letzte, 2010 verabschiedete Strategie ablösen. Jene war in einem breit angelegten moderierten Diskursprozeß entworfen worden. Zivilgesellschaftliche Akteure und Experten aus der Zivilgesellschaftsforschung hatten in mehreren Runden viel Zeit investiert, um Ziele und Inhalte zu benennen, intensiv zu erörtern sowie Formulierungsvorschläge zu machen. Aber: Von all dem blieb wenig übrig. Das Bundesfamilienministerium nutzte die Vorlagen sehr selektiv, um ein Papier zu erarbeiten, das der damaligen politischen Spitze gefiel. Die Strategie wurde verabschiedet; danach hörte man nicht mehr viel davon. Die Erfahrungen mit solchen Strategien sind also miserabel.
Nun also eine neue – „mit der Zivilgesellschaft“? Aber was sollte drinstehen? Eine Idee war, den Begriff Engagement neu zu definieren, eine andere, dort die Gravamina aufzulisten, die die Zivilgesellschaft im Hinblick auf ihren rechtlichen Rahmen hat, also darzustellen, wo diese Zivilgesellschaft der Schuh drückt. Noch weiß kaum jemand außerhalb der Ministerien und eventuell einiger einbezogener Kreise von ausgewählten Personen, was die Strategie letztlich beinhalten wird. Klar ist von vornherein nur eines: Ein politisches Interesse besteht an diesem Projekt in keinem der beteiligten Bundesministerien, im Familienministerium ebensowenig wie im Innenministerium und schon gar nicht im Finanzministerium. Oder doch? Geht es vielleicht im Kern nicht um eine Engagementförderstrategie, sondern um eine Engagementkontrollstrategie? Wie so vieles, das politisch gewollt wird, wird auch dies nicht offen gesagt. Man wird den Text sehr genau anschauen müssen, um zu sehen, was tatsächlich gewollt ist.
Was das „mit der Zivilgesellschaft“ betrifft, so ist das Projekt in den Händen der zuständigen Beamten zu einem dünnen Rinnsal von Diskussionsrunden geronnen, welches zu koordinieren die – staatliche – Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt beauftragt wurde. Selbstermächtigte Initiativen, etwa des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement[1], das zwar ebenfalls am Tropf des Staatshaushalts hängt, sich aber in der Vergangenheit als nicht leicht steuerbar erwiesen hat, wurden allenfalls zur Kenntnis genommen, ebenso die Bemühungen, im Unterausschuß Bürgerschaftliches Engagement des Bundestages einen Diskurs in Gang zu bringen.
Was bisher als Eckpunkte bekannt geworden ist, bietet Anlaß zu großer Sorge. Engagement wird nur, soviel ist durchgesickert, als an der Basis der „freiheitlich demokratischen Grundordnung“ orientierter Einsatz benannt. Was bedeutet in diesem Fall Basis und was die freiheitlich demokratische Grundordnung? Gehören damit bestimmte Protestformen wie die Klimakleber nicht mehr zum Engagement? Ist es in einer Definition, die breite Kreise der Bürgerinnen und Bürger ansprechen und verstehen soll, sinnvoll, mit der „freiheitlich demokratischen Grundordnung“ zu argumentieren, einem kontaminierten, in den 1980er Jahren in politischen Kreisen Westdeutschlands beliebten, zur Vernebelung der Attribute ‚Freiheit‘ und ‚Demokratie‘ als FDGO abgekürzten, letztlich vor allem abgedroschenen Begriff?
Was ist geplant?
Bekannt ist, dass eine Neudefinition des Engagements eine wesentliche Rolle spielen soll. Richtig ist, dass sich das Engagement in Ausdrucksformen und Zielen seit 2010 deutlich verändert hat. Aber ist es in einer freiheitlichen Gesellschaft wirklich Sache des Staates, oder nicht vielmehr Sache der Engagierten, zu definieren, wofür sie sich engagieren wollen? Es drängt sich also der Verdacht auf, der Bund wolle über solche Festlegungen das (nach seiner Auffassung) gute vom (nach seiner Auffassung) schlechten Engagement trennen, um einen Maßstab mit normativem Anspruch für seine Förderpolitik zu gewinnen.
Eine wichtige Frage ist: An wen richtet sich denn die Strategie? An alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft? Oder sollen Unterschiede aufgemacht werden? Ginge es tatsächlich um eine Aufarbeitung des Engagements im dann notwendigerweise internationalen Kontext, müssten auch internationale Konventionen, vor allem die Menschenrechts-Konventionen der UNO und des Europarats, eine Rolle spielen. Oder sind nur Deutsche gemeint (vgl. Art. 116 GG)? Nicht EU-Bürgerinnen und -bürger (vgl. Art. 2, 3, 7 und 9 bis 12 EUV, Art. 18 bis 25 AEUV und Art. 39 bis 46 der Charta)? Soll etwa Engagement nur auf den nationalen, vom Bund kontrollierbaren Rahmen beschränkt bleiben?
Ein großes Thema ist die Unentgeltlichkeit. Es wäre gefährlich, am grünen Tisch der Ministerien Aussagen dazu zu entwerfen, die entweder realitätsfern oder demokratietheoretisch bedenklich sind. In der Vergangenheit gab es dazu viel Klientelpolitik! Übungsleiterpauschalen haben beispielsweise mit Auslagenersatz nichts zu tun. Auch andere Formen der Wertschätzung sollten angesprochen werden. All dies gehört – nicht nur mit Verbandsvertretern, die, völlig zu Recht, ihre Interessen vertreten – gründlich erörtert.
Was sollte eine Strategie beinhalten?
Zumindest sollte eine neue Engagementstrategie die Veränderungen aufzeigen, die das Engagement in den letzten Jahren erfahren hat und Orientierungen für die Zukunft bieten. Digitalisierung, Zuwanderung, Zunahme des informellen Engagements, Folgen der staatlichen Corona-Politik, Veränderungen der geopolitischen Gesamtlage, Flüchtlingspolitik sind nur einige der Stichworte, zu denen man in der Strategie etwas finden sollte.
Wie steht es um Engagementformen, die im informellen Bereich liegen? Wenn jemand individuell eine hilfebedürftige Person (Schüler, Migrant, körperlich eingeschränkte Person) unterstützt, erkennt das der Staat als Engagement an? Wohlgemerkt, es geht dabei nicht um etwaige finanzielle Unterstützung.
Und wie steht es um das Engagement in öffentlichen Einrichtungen? Die Freiwilligen Feuerwehren sind ein wichtiges Beispiel: Fast 1 Million Engagierte sind in diesen kommunalen Einrichtungen engagiert. Aber auch das Engagement in öffentlichen (kommunalen) Bibliotheken, in Museen usw. wären einzubeziehen, vielleicht sogar im Bereich von Wirtschaftsunternehmen.
Schließlich ist zu überlegen, ob der Begriff des ‚bürgerschaftlichen‘, der zunehmend von rechten Kräften in Anspruch genommen wird, zumindest durch den Begriff ‚zivilgesellschaftliches Engagement‘ ersetzt oder zumindest ergänzt wird.
Zwei Themenfelder werden, wie man hört, nicht behandelt werden: der Bürokratieabbau und die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts. Beide liegen den Engagierten und den Akteuren der Zivilgesellschaft, in denen 80% von ihnen engagiert sind, besonders am Herzen.
Aus diesen Beispielen wird deutlich: Was wir brauchen, ist ein Bekenntnis von Bundesregierung und Bundestag, von den Parteien, den Ländern, den Medien und anderen Eliten zur engagierten Bürgerin, zum engagierten Bürger, zur Zivilgesellschaft als Partnerin im Kampf um die Resilienz der Demokratie. Das aber ist offenbar nicht gewollt.
Worum geht es tatsächlich?
Dass die 700.000 zivilgesellschaftlichen Organisationen, die nicht nur unverzichtbare Aufgaben für das Gemeinwohl übernehmen, sondern in denen sich 80% des bürgerschaftlichen Engagements vollziehen, unter den immer aggressiveren Bürokratiemonstern leiden, die der Staat unablässig für sie gebärt, ist evident, wird aber kaum thematisiert. Wenn Vereine keine Kassenwarte und Schriftführer mehr finden, wenn immer mehr hauptamtliches Personal gebraucht wird, dann hat das hier seine Ursache. Mit Sonntagsreden ist hier niemandem geholfen; die überbordende Bürokratie erstickt jedes Engagement. Hier wäre entschlossenes Handeln angesagt. Dieses aber, so befürchten die Strategen in den Ministerien, könnte die zivilgesellschaftlichen Akteure am Ende aus der Unmündigkeit befreien.
Ähnlich steht es mit der Reform des Gemeinnützigkeitsrechts. Seit 1998 in jedem Koalitionsvereintrag versprochen, wird sie auch jetzt nicht angegangen. Es wird bei kleinen Ergänzungen bleiben, die zwar mit Förderung des Engagements verkauft werden, aber im Grunde nichts damit zu tun haben. Hier wird Engagement behindert, nicht gefördert. Das ist „des Pudels Kern“.
Es ist nur allzu klar: Den Parteien ist das bürgerschaftliche, schon gar das zivilgesellschaftliche Engagement zutiefst suspekt. Sie fürchten den Wettbewerb von Akteuren, die mehr für den sozialen Wandel tun, mehr Vertrauen genießen, weniger Steuergeld verbrauchen als sie. CDU und CSU haben in dem laufenden Diskurs um die Einführung eines europäischen Vereinsrechts deutlich gemacht, wie sie strategisch mit diesem Wettbewerb umgehen. Im Europäischen Parlament, im Bundesrat und im Bundestag werden synchron Vorstöße gegen eine Ausweitung der Rahmenbedingungen und für mehr Kontrollen unternommen. Den Begriff Zivilgesellschaft, in Praxis und Wissenschaft heute weltweit eingeführt, lehnt sie nach wie vor ab. Die FDP hält ohnehin nichts von der Zivilgesellschaft, nimmt ihre Verantwortung für eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts nicht wahr und blockiert das Demokratiefördergesetz. Bei den anderen Parteien sieht es nicht viel anders aus. Der Versuch, in einer neuen Engagementstrategie andere Anliegen, etwa die Bekämpfung von illiberalem Extremismus oder die Forderung nach mehr Transparenz unterzubringen, wirkt schon deswegen wenig überzeugend, weil zu erwarten ist, dass die neue Engagementstrategie ebenso folgenlos bleibt wie ihre 2010 entwickelte Vorgängerin.
Einen geradezu perversen Lichtblick bietet eine ganz andere Entwicklung: Die Kassen des Bundes (und der Länder) sind bekanntlich leer. Förderungen zivilgesellschaftlicher Akteure aus öffentlichen Mitteln werden nicht auf dem Niveau von heute fortgesetzt werden können. Im Gegenteil: Bei der fraglos an ihr Ende gekommenen Subventionsstrategie der letzten Jahre wird die Zivilgesellschaft, die sich leider nicht so stark artikulieren kann wie diverse Branchen der Wirtschaft, bei den Kürzungen und Streichungen ganz sicher oben auf der Liste der Prioritäten stehen. Für viele wird das außerordentlich schmerzlich sein, manche werden das nicht überleben. Es wird einen Schrumpfungsprozeß geben, aber dieser wird mit größerer Unabhängigkeit einhergehen. Wenn der Bund gleichzeitig im großen Stil Fördermittel streicht und mehr Kontrolle ausüben will, kann dies nicht funktionieren. Jede Organisation, die es schafft, sich aus dem Würgegriff der öffentlichen Förderung zu befreien, wird um so unabhängiger dem Staat und den Parteien gegenüber treten.
Das Schenken der Bürgerinnen und Bürger an die Gesellschaft bedarf letztlich keiner Strategie des Staates. Es entfaltet sich selbstermächtigt und selbstorganisiert und Formen, die weit über das hinausgehen, was Behörden unter ihre Kontrolle bringen können. Es hat für unsere Gesellschaft herausragende Bedeutung. Es ist abzusehen, dass der Stellenwert des Engagements in der nächsten Zeit stark zunehmen wird. Das Engagament wird in seiner ganzen Breite gebraucht und ist für unsere ganze Gesellschaft ein Anspruch. Dabei muss es sich erneut darin behauten, nicht nur auf die Funktion als Lückenbüßen beschränkt zu werden. Eine Gesellschaft, in der nicht geschenkt wird, verelendet. Der Bund sollte sich also gut überlegen, was er mit seiner Engagementstrategie eigentlich anrichtet. Am schwersten wiegt, dass er Gefahr läuft, damit Heerscharen von engagierten Partnern zu verlieren, die ihm dabei helfen, Illiberaliät, Extremismus jeder Art, Autoritarismus und andere Tendenzen, die das Ende der Demokratie einläuten können, zu untergraben. Kann das eine sinnvolle Strategie sein?
Dr. sc. oec. Eckard Priller ist wissenschaftlicher Koordinator der Maecenata Stiftung.
Dr. phil. Rupert Graf Strachwitz ist Vorstand der Maecenata Stiftung.
[1] S. hierzu: https://www.b-b-e.de/projekte/beitraege-des-bbe-zur-bundes-engagementstrategie/